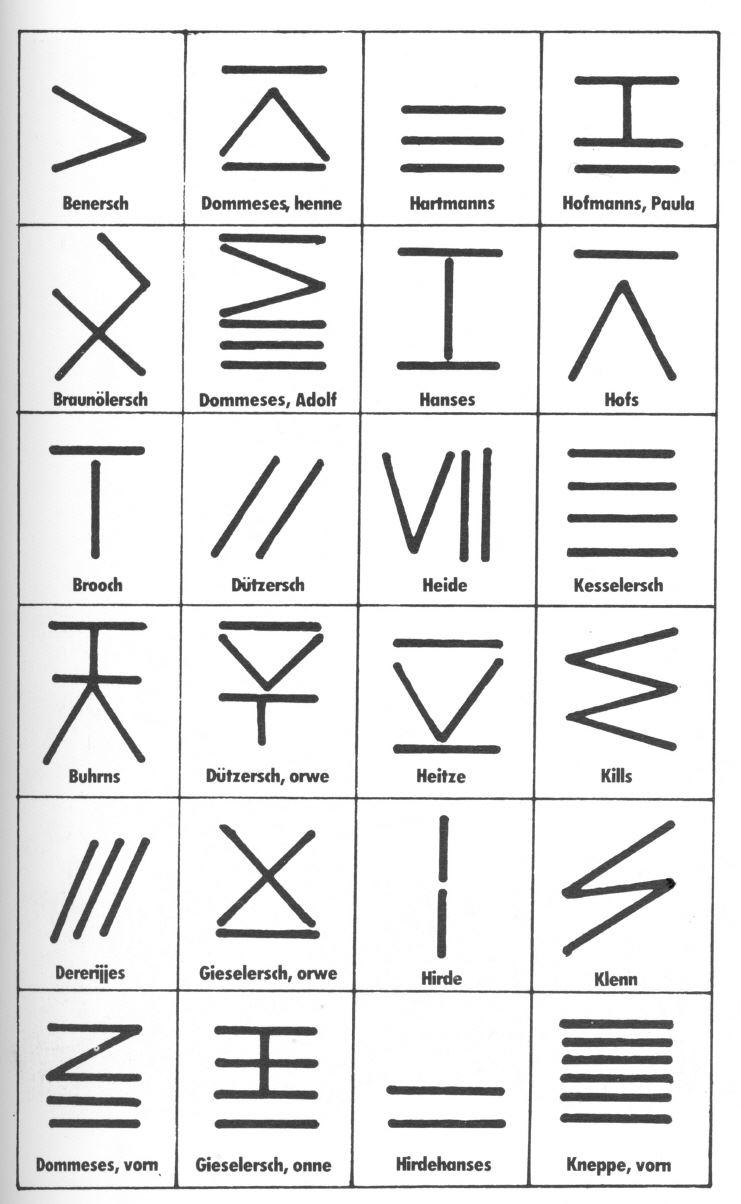Hauberg in Flammersbach
Haubergswirtschaft
Seit altersher gingen die Flammersbacher neben Ihrem Beruf auch dem Nebenerwerb, der Landwirtschaft nach. Im Frühjahr wurde der Hauberg bearbeitet, wo früher auch noch Loh geschält wurde. Mühselig wurde mit dem Beil das Holz gehauen. Von dünnen Ästen wurden Schanzen gebunden (für`s Brotbacken) und das feine Birkenreisig wurde zu Besen verarbeitet. In den letzten Jahren lebte die Haubergsarbeit - hervorgerufen durch die Öl- und Energiekrise - wieder auf.
Die Fichte ist Geschichte
Es gab einmal eine Zeit, da waren im Siegerland noch keine großräumigen Flächen mit ausschließlich Fichtenbesatz zu finden. Johann Christian Senckenberg, Naturwissenschaftler und Namensgeber des bekannten Frankfurter Naturmuseums, besuchte anno 1736 unsere Region und notierte in seinem Tagebuch: „Tannen und Fichten sind wenig oder keine hie.“ Dass ihm dieser Umstand bemerkenswert erschien, deutet darauf hin, dass er in anderen Gegenden eine größere Anzahl der immergrünen Nadelbäume vorgefunden hatte.
Und tatsächlich trat die Fichte ihren Siegeszug in vielen Teilen Deutschlands schon vor mehr als 300 Jahren an. Massive „Plünderungen“ der Wälder in Mitteleuropa hatten dazu geführt, dass in weiten Teilen eine Holzknappheit vorlag. Die damaligen Förster konnten viele der Landbesitzer – in der Regel waren es die Grafen und Fürsten – davon überzeugen, dass es eine Baumart gibt, die nicht nur schnell wächst, sondern dazu auch noch ein hervorragendes Holz liefert. Weitere Vorteile waren ihre Anspruchslosigkeit und der gerade Wuchs. So rasch wie von den Waldbesitzern gewünscht konnte der Holzmangel zwar nicht behoben werden, doch angesichts der Alternativen bot sich die Fichte ganz einfach als allerbeste Wahl an.
Doch es gab auch Gegenden, in denen eine Anpflanzung von Fichten gar kein Thema war, weil ganz einfach keinerlei Holznot herrschte – im Gegenteil. Schon viele Generationen zuvor hatte hier eine Wechselwirtschaft Fuß gefasst, bei der die andernorts herrschende prekäre Situation praktisch ausgeschlossen war. Die Basis hierfür war die Nachhaltigkeit des Verfahrens. Dieses wurde Haubergswirtschaft genannt und war aus heutiger Sicht eine kulturelle Großtat. Noch einmal Senckenberg, der bei seinem mehrwöchigen Besuch eine Zeit lang im Schloss Hainchen wohnte: „Nachdem man … angehoben (angefangen) Hayne oder Hauberge zu machen, erholte sich das Landvolck. Die Hauberge sind stets ein sicher Capital und verzinsen sich wohl.“ Der Frankfurter schätzte den wirtschaftlichen Wert richtig ein. Dass die hiesige Bevölkerung ein auskömmliches Dasein genoss, hing eng mit den aus der Haubergsarbeit stammenden Erzeugnissen zusammen.
Gelegentlich hört man von ansonsten gut informierten Personen, dass sie alles, was den Hauberg anbelangt, noch nie so richtig verstanden hätten. Ich will darum versuchen, dessen „Geschäftsmodell“ so einfach wie möglich zu erklären. Auf entbehrliche Einzelheiten soll bei dem „trockenen Thema“ verzichtet werden.
Beginnen wir mit den Besitzverhältnissen. Die Verfasser des „Siegerländer Wörterbuchs“ nahmen an, dass diese gegen Ende des 15. Jahrhunderts grundlegend festgeschrieben wurden. Die nassauische Regierung verordnete, dass der gesamte Waldbesitz einer Ortschaft nach bestimmten Regeln genutzt werden müsse. Jeder Hauseigentümer wurde mit seinen Besitzanteilen Mitglied in einer Haubergsgenossenschaft. Durch Erbteilung und Verkauf konnten sich die ursprünglich gleichgroßen Anteile ändern.
Das Konzept entspricht im Prinzip demjenigen einer Aktiengesellschaft. Deren Grundkapital ist in Aktien zerlegt, die den Eigentümern auf einer Aktionärsversammlung ein Stimmrecht sichern. Genau so ist es auch bei der Genossenschaft. Wer viele Anteile hat, dessen Stimme hat bei Beschlüssen ein entsprechend größeres Gewicht. Ein ganz wichtiger Unterschied ist freilich, dass Aktien lediglich Wertpapiere darstellen – niemand von den Aktionären muss in der ihm anteilig gehörenden Fabrik arbeiten. Haubergsanteile hingegen berechtigen den Besitzer, die Produkte der ihm zugewiesenen Fläche für sich zu nutzen.
Fahren wir fort mit der Methodik der Nachhaltigkeit. Hierzu wurde der Wald als Gesamteigentum in möglichst gleich große Bereiche aufgeteilt. In der Regel wurden 16 bis 20 Areale gebildet. Im ersten Jahr wurde eine dieser Teilflächen gefällt. Jeder Genosse bekam eine Stelle zugelost, die der Größe seines Anteils entsprach. Im nächsten Jahr geschah dies bei einer anderen Teilfläche. Da war auf der Vorjahrsparzelle das aus den Wurzelstöcken nachwachsende Holz schon wieder ausgetrieben. Und wenn der letzte Bereich abgeholzt war, dann war der erste wieder schlagreif. Bei diesem Reihum-Verfahren war gewährleistet, dass Jahr für Jahr die gleiche Menge Holz zur Verfügung stand. Nachhaltiger geht es nicht!
Werfen wir nun einen Blick auf die Erzeugnisse, die der Hauberg lieferte. Da war vor allem natürlich das Brennholz, das jeder Eigner im Frühjahr „ernten“ durfte. Das Entfernen des dünnen Unterholzes und der hieraus gefertigten Schanzen war eine Aufgabe für Frauen und Kinder, während das Fällen aller Holzarten – vorwiegend waren dies Birken – ausschließlich eine Sache der Männer war. Eine Ausnahme bildeten die Eichenstämme. Bei diesen wurde im Mai zunächst die Rinde abgeschält. Diese enthält einen Gerbstoff, mit dessen Hilfe man Tierhäute zu Leder umwandelt. Jeder Eigner fuhr mit seiner Ausbeute zur Gerberei und erwirtschaftete durch den Verkauf der Rinde („Lohe“ genannt) einen finanziellen Gewinn. Die Stangen hingegen brachte man zu den Meilerplätzen. Die hier gewonnene Holzkohle fand Verwendung bei der Eisenverhüttung und bildete eine weitere wichtige Einnahmequelle.
Mit Ausnahme einiger Wintermonate zog sich die Bewirtschaftung über das ganze Jahr hin. Nach der Holzernte entfernte man vom Boden der kahlen Fläche Gras und Moos sowie sonstigen Bewuchs, der anschließend in Flammen aufging. Die Asche bildete den einzigen Dünger für das „Haubergskorn“, das eingepflügt und im Jahr darauf mit der Sichel geerntet wurde. Aus dem hieraus gewonnenen Mehl backte man im gemeindeeigenen Backhaus ein sehr gesundes Schwarzbrot. Dazu eignete sich das gedroschene Stroh als Streu im Stall sowie auch ganz gut zum Decken von Dächern. Nach einem halben Dutzend Jahren durften schließlich die Hirten bis zum nächsten Holzabtrieb ihre Großviehherde zur Beweidung in den Hauberg treiben.
Nicht vergessen werden dürfen die Heidelbeeren, die eimerweise gesammelt und verkauft wurden sowie der Ginster, der im zweiten Jahr nach der Abholzung urplötzlich in einer unzählbaren Fülle auflebt und den jungen Hauberg in ein einziges Blütenmeer verwandelt. Der Ginster ist nicht nur eine „Augenweide in Gelb“, sondern er wurde früher ab dem vierten, fünften Jahr nach seinem Auftauchen auch mit einer „Ginstersichel“ geerntet. Man konnte ihn häckseln und als Viehstreu verwenden, aber auch – zu Schanzen gebunden – im Außenbereich von Stall und Scheune als Kälteschutz aufstellen. Die schönste Haubergsblume indes blüht im späten Frühling gleichfalls in größeren Mengen im jungen Wald wieder auf. Es ist der Rote Fingerhut, dessen purpurne Glockenreihen nicht verraten, dass sie das giftige Digitalin enthalten, welches als Arzneimittel genutzt wird.
Zusammengefasst sieht man, dass „die Hauberge ein sicher Capital“ waren und durch den vielfältigen Nutzen dazu beitrugen, dass die dörfliche Bevölkerung ein hinlängliches Wohlergehen genoss. Dies sahen auch die Landesherren so, die ja durch die fälligen Abgaben ebenfalls hiervon profitierten. Und darum standen die Nassauer und später die Preußen im Laufe der Jahrhunderte im eigenen Interesse hinter dem Geschäftsmodell und regelten durch diverse „Holz- und Waldordnungen“ die Haubergswirtschaft in ihrem Machtbereich.
Wer sich das bisher Gesagte vor Augen führt, der wird nicht den geringsten Grund für die eingangs angesprochene Anpflanzung von Nadelbäumen finden. Bis dass diese einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden konnten, vergingen ja sechzig oder achtzig Jahre. Die währenddessen heranwachsenden Generationen hätten nicht den geringsten Nutzen von dieser Anpflanzung gehabt. Kein Förster hätte unseren Vorfahren solches schmackhaft machen können. So wurde der grandiose Blick von den Hügeln auf den sich in unterschiedlichen Entwicklungsstufen befindenden Hauberg nicht durch größere Nadelholz-Bestände verstellt.
Es vergingen Jahrhunderte, bis dass düstere Wolken am Haubergshorizont aufzogen. Und diese kamen in Form der Erschließung des Siegerlandes durch die Eisenbahn. Nachdem 1861 die Sieg-Ruhr- Linie eingeweiht worden war, folgte schon ein Jahr später die durch Betzdorf und das Hellertal führende Deutz-Gießener Eisenbahn. Für den heimischen Wirtschaftsraum war dies fürwahr ein willkommenes Geschehnis, doch für den Wald in der herkömmlichen Bearbeitungsform war es der Beginn des Niedergangs. Der Transport auf den Schienen war viel kostengünstiger als der auf der Straße. Koks und Steinkohle wurden hierdurch preiswerter als die in den Meilern mühsam produzierte Holzkohle. Ein ganz wichtiger Erwerbszweig fiel weg.
Als kurz darauf auch noch in den Gerbereien anstelle der Eichenlohe das südamerikanische Quebrachoholz und dazu billigere chemische Gerbmittel zur Anwendung kamen, war der traditionelle Ablauf nachhaltig gestört. Weil auch das Eichenholz nun nur noch zum Verbrennen im Ofen dienen konnte, ergab sich eine Überproduktion. Unzählige Generationen zuvor hätten nicht im Traum daran gedacht, dass irgendwann die Haubergsflächen zu groß für den jährlichen Bedarf ihrer Nachkommen sein würden. Dies alles vollzog sich freilich schrittweise, manches Jahrzehnt verging noch im halbwegs gewohnten Rhythmus.
Von 1890 bis 1934 übten zwei meiner Urgroßväter nacheinander das Amt des Haubergsvorstehers in Flammersbach aus. Sie waren als Landwirte – ebenso wie viele ihrer Genossen – auch auf die durch die Arbeit im Hauberg zu erzielenden Gewinne angewiesen. Ihre landwirtschaftlichen Flächen waren wegen des überragenden Stellenwerts des Haubergs so klein, dass auf ihnen lediglich der Eigenbedarf gedeckt werden konnte. Und daher traten sie mit Erfolg dafür ein, die nun nicht mehr benötigten Haubergsflächen in Ortsnähe zu roden und urbar zu machen. Die auf den zusätzlichen Feldern geernteten Kartoffeln und Getreidearten wurden verkauft und milderten den finanziellen Verlust. Im gesamten Siegerland wurden ähnliche Schlussfolgerungen gezogen.
Es gab aber noch eine weitere Möglichkeit. Und hier beginnt die Geschichte der Fichte in der Haubergsgegend. Nun war nämlich die Stunde derjenigen gekommen, die eine Anpflanzung von Nadelbäumen auf entbehrlichen Flächen als eine geeignete Alternative empfahlen. Nach und nach ließen sich viele Haubergsbesitzer hiervon überzeugen. Vor allem auf den weitab gelegenen Parzellen und auf den steilsten Hängen pflanzten die Genossen die ersten Fichtenkulturen. Auch in der nachfolgenden Zeit blieben die Nadelbäume die erste Wahl bei der Bepflanzung von überzähligen Arealen.
Drei Generationen später trugen die Maßnahmen der Vorfahren Früchte. Der Verkauf der ältesten Fichten brachte vor rund fünf Jahrzehnten so viel Geld in die Kasse, dass erstmals in der viele hundert Jahre umfassenden Geschichte des Flammersbacher Haubergs „Dividende“ in Form von Bargeld an die Anteilseigner ausgeschüttet werden konnten. Und die Verständigeren unter den Genossen wussten natürlich genau, dass sie dies der Handlungsweise ihrer Ahnen zu verdanken hatten.
Der Bedarf an Brennholz wurde unterdessen wegen des damals sehr billigen Öls und anderer Energieträger immer geringer. Viele Anteilseigner verloren das Interesse an der Arbeit im Wald. Und als Folge machten immer mehr traditionelle Laubwaldflächen der Fichte Platz. Dass dies Naturschützer auf den Plan rief, darf nicht überraschen.
Der Hilchenbacher Ehrenbürger Wilhelm Münker (1874 – 1970) war in unserer Region der bekannteste unter ihnen. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hatte er dem Altenaer Lehrer Richard Schirrmann mit Rat und Tat helfend unter die Arme gegriffen, um dessen Idee zur Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten für die wandernde Jugend zu verwirklichen. Das Deutsche Jugendherbergswerk verdankte der organisatorischen Kraft Münkers zu einem sehr großen Teil seine Existenz.
Für den Siegerländer Wald indes wurde der begeisterte Wanderer und SGVer vor allem dadurch wichtig, dass er in zahlreichen Abhandlungen immer wieder eindringlich eine Lanze für den Laubwald brach. Der Hilchenbacher war realistisch genug, um anzuerkennen: „Es ist ein wirtschaftliches Unding, in Zeiten größter Holznot draußen im Walde nur Brennholz zu ziehen. Das gibt es … in ganz Deutschland schon lange nicht mehr. Dabei sind sich alle einig, dass leider die anspruchsvolle und sehr langsam wachsende Eiche nur noch in beschränktem Umfang gehalten werden kann. Die Kernfrage lautet also, mit welchem Hundertsatz soll die Fichte Einzug halten?“ An anderer Stelle äußerte er sich ähnlich: „Keiner will die Fichte verbannen. Jeder weiß, dass wir sie gar nicht entbehren können.“ Doch mit Nachdruck stellte er abschließend fest: „Aber was zu viel ist, ist zu viel!“ Manch ein Haubergsgenosse wird bei diesen Sätzen wohl nachdenklich geworden sein.
Kurz nach dessen Eröffnung vor knapp zwei Jahrzehnten erwanderte ich mit einer SGV-Gruppe den Rothaarsteig von Dillenburg nach Brilon. Bis zur Ginberger Heide hielt sich der Anteil der Fichten am Wegesrand in Grenzen. Von da ab jedoch säumten rechts und links kontrastarme Nadelbäume den Weg. Hierdurch hielt eine düstere und ermüdende „Monotonie unter Fichten“ bei den Wandernden Einzug. Stundenlang sah man mitunter kaum ein grünes Blatt, man vernahm kein Vogelgezwitscher, kein Reh und kein Hase ließen sich sehen. Für einen naturinteressierten Wanderer ist eine derartige Eintönigkeit – noch dazu auf einem „Weg der Sinne“ – einfach deprimierend!
Ein Jahr nach dem Kyrill-Orkan wanderte ich erneut auf dieser Strecke. Die unzähligen Stümpfe der umgeblasenen Fichten stellten zwar auch keine optische Offenbarung dar, doch nun konnte man wenigstens den Blick in die Weite schweifen lassen und die zuvor verstellten Ausblicke genießen.
Wandersmann „Willi“, wie Münker freundschaftlich von seinen Bekannten genannt wurde, hatte wohl diese Region vor Augen als er feststellte: „Auf den Bergen wird es schwarz und immer schwärzer. Der Siegeszug der Fichte geht nahezu ungehemmt weiter.“ Und die Gründe für seine kritische Einstellung erstreckten sich keineswegs nur auf den Aspekt des Wanderns: „Die Nachteile betreffen vor allem die bedenkliche Schädigung der Bodenwuchskraft, die vermehrte Anfälligkeit für Feuer, Bruch und Käfer sowie die starke Minderung der nutzbar werdenden Wassermenge und schließlich auch die Verödung der Landschaft. Man überlässt den Enkeln und Urenkeln die Sorge, mit dem fast hoffnungslos verdorbenen Boden fertig zu werden.“
Seine Warnungen gipfelten in einer Stellungnahme im Heimatkalender 1968: „Und wie war es doch mit der unheimlichen Dürre 1959? Wenn nun gar zwei solcher Jahre hintereinander kämen? Es gäbe eine Katstrophe von gar nicht vorstellbarem Ausmaß. Noch immer rächt sich jegliche Sünde wider die Natur. Zu alledem: Gilt nicht seit Jahrhunderten bei allen Wirtschaftlern der alte Lehrsatz: Du sollst nicht alles auf eine Karte setzen?!“
Dass diese Sätze prophetischer Natur waren, zeigt sich derzeit. Wir erlebten zwei Dürrejahre hintereinander und im Anschluss ein trockenes Frühjahr, das die Vermehrungsfreude des von Münker genannten Käfers enorm anregte. Tageszeitungen, Magazine und das Fernsehen berichteten immer wieder mit bestürzenden Bildern über hingestreckte Wälder. Und wer sich selbst auf eine Wanderung begibt, der benötigt nicht lange um vor einem der unzähligen Brachfelder zu stehen. Das nur sechs Millimeter große Insekt hat die Wasserknappheit und den hieraus resultierenden Mangel des schützenden Harzes dazu genutzt, dass die „Katastrophe“ tatsächlich kam.
Die Gesundheit des Waldes, in dem auch Buchen und Eichen „schwächeln“, war noch nie so schlecht. In der der forstlichen Welt ist dies das alles beherrschende Thema. Keiner unter den derzeit lebenden Förstern hat so etwas in seiner Laufbahn erlebt. Die trotz aller Gegenmaßnahmen nicht zu stoppende Borkenkäferart mit dem unverfänglichen Vornamen „Buchdrucker“ dürfte seinem Wirt, der Fichte, wohl eher über kurz als über lang den Garaus machen.
Unbeeindruckt vom Toben des wilden Riesen Kyrill pflanzten viele Eigner seinerzeit auf den Kahlflächen erneut Fichten an. Man hatte den Knall nicht vernommen. Die Titanic sank, die Kapelle spielte weiter. Es musste erst ein unter der Borke kriechender sanfter Winzling in regenarmen Jahren kommen, damit bei den frustrierten Waldbesitzern ein Umdenken einsetzte. Doch ihre Ratgeber, die Forstleute, sind einstweilen selbst noch ratlos. Welche Baumart wird mit den künftig zu erwartenden Anforderungen klar kommen? Welche wird dazu einen wirtschaftlichen Erfolg bringen? Gefragt sind Konzepte für die nächsten Stürme, Hitzewellen und Käferinvasionen. Willi Münker hatte sich seine Meinung schon 1958 gebildet. Da erschien sein 400 Seiten dickes Buch mit dem Titel „Dem Mischwald gehört die Zukunft“. Viele vorausschauende Waldbesitzer und Forstleute kommen in dem Werk im Titelsinne zu Wort.
Zu deren Glück gibt es Haubergsgenossenschaften, die nicht alles auf eine Karte setzten. Eine nicht geringe Anzahl hat sogar den Fichtenanteil unterhalb der 40-Prozent-Grenze gehalten. Der Weidenauer Heimatautor Hermann Böttger befürchtete zwar im Heimatkalender 1952: „Langsam aber sicher wird der Hauberg aus der Siegerländer Landschaft verschwinden; am Ende des Jahrhunderts wird er der Vergangenheit angehören.“ Weil aber die Verantwortlichen danach bei Neuanpflanzungen auch der Buche den Vorzug gaben, Eichen zu Hochwald wachsen ließen und den Wald wieder in stärkerem Maße zur Brennholzgewinnung nutzten, ist Böttgers Mutmaßung nicht eingetroffen. Und deshalb prägen immer noch große Laubwaldanteile das Landschaftsbild.
Am nördlichen Ortseingang von Flammersbach blies 2007, der schon genannte Kyrill, ein an der Kreisstraße liegendes Fichtenwäldchen beinahe komplett um. Weil die Bebauung auf der anderen Straßenseite inzwischen an das etwas mehr als ein Hektar große Areal angrenzte, verbot sich eine erneute – und zudem kostspielige – Bepflanzung mit Fichten. Und so überließ man das Grundstück erst einmal sich selbst und pflanzte nicht einen einzigen Baum. Es ist ein grüner Mischwald entstanden, in dem sich unter anderem Espe, Haselnuss, Ahorn, Weide, Holunder, Birke, Eberesche, Eiche, Kirsche und Buche, dazu jede Menge Sträucher und sonstiges Gehölz um die Fichtenstümpfe versammelt haben und dem Ortseingang ein überaus freundliches Bild verschaffen.
Bei diesem Anblick drängt sich der Gedanke auf, dass vielleicht tatsächlich ein natürlich gewachsener Mischwald mit den Katastrophen der Zukunft klar kommen kann – vom wirtschaftlichen Ertrag einmal abgesehen. Und dann könnte die Zeit gekommen sein, in der erneut ein das Siegerland besuchender Naturwissenschaftler in sein Tagebuch schreiben wird: „Fichten sind wenige oder keine hier.“
Aus dem Buch „Es gab einmal eine Zeit…“ von Ulli Weber